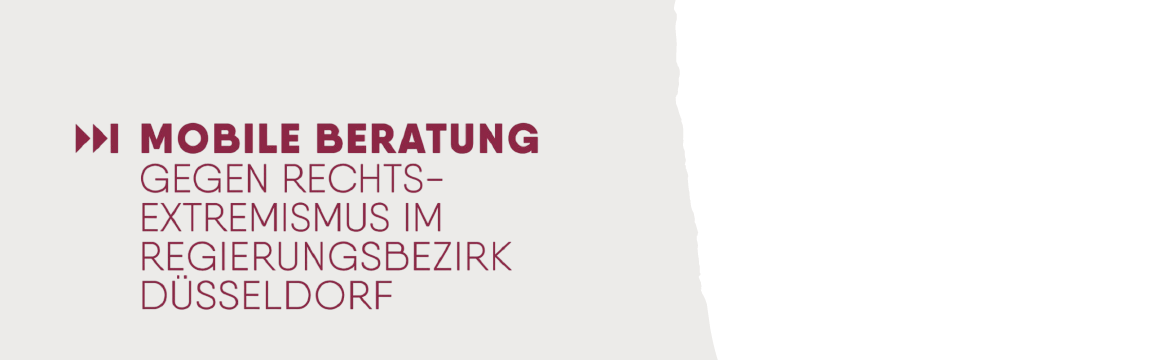Rassistische und Rechtsextreme Äußerungen in Klassenchats stellen schulisches Personal immer häufiger vor große Herausforderungen. CleaRExchange, das digitale Austausch- und Netzwerkformat im CleaRNetworking, befasste sich in seiner siebten Ausgabe mit „Umgangsstrategien für Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende“ mit diesem schwierigen Thema. Geleitet wurde der Workshop von Lillian Mettler und Dominik Schumacher von der mobilen Beratung gegen Rechts im Regierungsbezirk Düsseldorf.
Mobile Beratung gegen Rechts: Angebote und Aufgaben
Die mobile Beratung gegen Rechts ist ein sozialwissenschaftliches Konzept, auf dessen Grundlage seit den 1990er Jahren im gesamten Bundesgebiet Beratungsteams entstanden sind, die engagierte Menschen, Vereine, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Politik und Verwaltung mit dem Ziel unterstützen, eine demokratische Kultur zu stärken. Sie beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen. Hat schulisches Personal Unterstützungsbedarf, kann es sich sich entweder an den Bundesverband [1] wenden oder eines der Landesteams kontaktieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es z.B. fünf dieser Teams. Konkret bestehen die Aufgaben der mobilen Beratung gegen Rechts in:
- Beratung, Unterstützung bei Problemlagen im Bereich Rechtsextremismus und Rassismus (interventiv);
- Qualifizierung und Begleitung (präventiv);
- Politische Bildungsarbeit:
- Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen;
- Vernetzung, Recherche und Dokumentation.
Der heutige Workshop gehe der Frage nach, „Was darf Schule bei rechtsextremen und rassistischen Äußerungen? Was darf sie nicht?“, erläuterte Lillian Mettler. Ziel sei die Stärkung der Handlungssicherheit schulischen Personals in diesem komplexen Themenfeld. Rechtsextreme Einstellungen gäbe es in jeder Schule, ergänzte ihr Kollege Dominik Schumacher. Und: „An keiner Schule in den letzten sieben Jahren hat Whatsapp keine Rolle gespielt“, umriss er die Relevanz des Workshops. Dies sei kein Wunder, denn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. Schüler:innen und schulisches Personal gäben ihre Einstellungen, Meinungen und Werte schließlich nicht einfach am Schultor ab. Sie brächten diese vielmehr direkt in die Schule hinein, in Schulunterrichte, in Diskussionen auf dem Pausenhof, in Gottesdiensten und Sportveranstaltungen und eben auch in Klassenchats. Allgemein ließen sich einige Gelingensbedingungen festlegen, um rechtsextreme und rassistische Einstellungen an Schulen nicht virulent werden zu lassen, so Schumacher:
- Lehrkräfte;
- Schulklima;
- Eltern;
- organisierte Rechte;
- und/oder organisierter Antirassismus;
Was kann und darf Schule?
Was kann und darf Schule bzw. schulisches Personal nun diesbezüglich tun und was vielleicht auch nicht? Schulen seien zwar zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet, nicht jedoch zur Wertneutralität, so der Referent. Daraus ergebe sich ein grundsätzlicher Handlungsauftrag an schulisches Personal. Dieser Auftrag sei auch juristisch kodifiziert, z.B. in den Schulgesetzen der Bundesländer. Ein Beispiel: Das Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen fordert schulisches Personal explizit dazu auf, Schüler:innen vor Diskriminierung zu schützen, um sie zu eigenverantwortlichen, mündigen und kritischen Bürger:innen zu erziehen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit schränke Schüler:innen demgegenüber in ihrer Entfaltung und Lernfähigkeit stark ein. Verantwortungsträger:innen seien somit angehalten, zu einem guten Schulklima beizutragen, betonte Schumacher.
Der Klassenchat sei hier als ein Spezialfall anzusehen, denn:
- Der Chat existiert nur aufgrund des schulischen Kontextes, daher kein „privates“ Thema;
- Der Chat stellt soziale Dynamiken im Klassenraum, Schulhof und Unterricht erst her;
- Macht- und Unterdrückungsdynamiken im Chat haben reale Auswirkungen und betreffen darum den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule;
Rechtlich sei ein Klassenchat öffentlich, so Schumacher, womit auch die Strafbarkeit von Äußerungen, z.B. mit Blick auf Volksverhetzung einhergehe. Die Denunzierung von Schüler:innen als „Petze“ könne jedoch schwerwiegende psychische Folgen für die Betroffenen haben, mahnte der Referent. Für schulisches Personal ergebe sich hier ein Spannungsfeld zwischen pädagogischer Aufarbeitung und dem Schutz von Betroffenen. Zur Auflösung desselben gab der Schumacher den Teilnehmenden einige Tipps an die Hand:
- Mutige und Betroffene Schüler:innen schützen, nicht als „Verräter:in“ stigmatisieren (lassen), auch wenn ein Widerspruch zwischen jugendlichem Ausprobierraum und notwendigem Jugendschutz besteht;
- Den Vorfall als Anlass nehmen, nicht festgeschriebene Kommunikations- und Verhaltensregeln neu auszutarieren. Anlass, über Zivilcourage zu sprechen;
- Einzelne Lehrkräfte nicht allein lassen – die gesamte Schule mit einbeziehen.
Moderierte Aufarbeitung rassistischer und rechtsextremistischer Vorfälle im Klassenchat
Treten rassistische und/oder rechtsextreme Vorfälle im Klassenchat auf, empfiehlt die mobile Beratung ganz im Sinne unseres Clearing-Ansatzes deren moderierte Aufarbeitung statt eines unstrukturierten Vorgehens. Diese folgt dem Schema Abfrage – Auswertung und unterstützt schulisches Personal dabei, jene Vorfälle mit den eigenen schulischen Bordmitteln zu bearbeiten. Die moderierte Aufarbeitung in der Klassengruppe verfolge das Ziel
a) einer retrospektiven Aufarbeitung des Geschehenen (Wie haben die Beteiligten den Chat wahrgenommen?) sowie
b) einer prospektiven Vision für das künftige Miteinander im Klassenchat (Wie soll in Zukunft miteinander kommuniziert werden?). Dieser Aushandlungsprozess könne ein wichtiger erster Schritt zu einer nachhaltigen Selbstregulierungskompetenz der Schüler:innen sein.
Damit diese gelinge, sei es wichtig, in der Aufarbeitung sozialer Erwünschtheit und Benotungsfurcht konsequent entgegentreten, so Schumacher. Dies gelinge z.B. durch eine glaubwürdige Zusicherung von Anonymität sowie eine externe und vertrauliche Moderation. Weitere Gelingensbedingungen sind z.B.:
- Ausreichend Zeit für die Beantwortung der Fragen der Schüler:innen;
- Eine gut vorbereitete, individualisierte Abfrage;
- Multiple-Choice-Beantwortung mit vorher angekündigter Veröffentlichung.
Abfrage im Klassenplenum: Was ist passiert?
In diesem Schritt geht es darum, das Geschehene gemeinsam mit der Klasse aufzuarbeiten und allen Schüler:innen die Möglichkeit zur Reflexion zu geben. Die Ziele der Aufarbeitung sind:
- Selbstreflektion (Wie geht es mir als Schüler:in mit dem Chat?);
- Sichtbarmachen von Mehrheitsverhältnissen in der Klasse;
- Die Grundlage für selbstgesteuerte Veränderung in der Klasse legen.
Einige Beispielfragen:
- Ist die WhatsApp-Gruppe für den Schulbezug sinnvoll?
- Ist die Gruppe für außerschulische Verabredungen sinnvoll?
- Sind mir verletzende/diskriminierende Beiträge aufgefallen?
- Gab es Memes und Sticker, die ich verletzend fand?
- Haben Memes und Sticker einen (unbewussten) Einfluss auf mich oder andere?
- Hat die Kultur in WhatsApp-Gruppen einen Einfluss auf die Klasse?
Auswertung: Ergebnisse vorstellen, diskutieren und Zukunftsperspektiven aufzeigen
In diesem Schritt geht es darum, die Ergebnisse des vorherigen Schritts den Schüler:innen vorzustellen und über diese mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein Ablaufbeispiel:
- Vorstellung der Ergebnisse
- Klärung von Verständnisfragen
- Gemeinsame Diskussion der Ergebnisse
Folgende Fragen können die Diskussion anleiten:
- Wie geht es euch mit den Ergebnissen?
- Was fällt auf?
- Wie habt ihr den Chat erlebt?
- Was glaubt ihr könnte Mitschüler:innen davon abhalten, sich zu beteiligen?
- Welche Inhalte findet ihr unproblematisch?
- Welche nicht?
- Warum?
- Zusammenfassung und Auswertung
- Folgetermine: Besprechung und Implementierung von Veränderungswünschen, z.B. über die künftige Administration des Klassenchats, Nettiquette-Vereinbarungen, Melderegeln usw.
Kein Allheilmittel, aber eine gute Chance
Rassismus und Rechtsextremismus sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und ließen sich natürlich nicht mit einer singulären Bildungsmaßnahme allein in den Griff bekommen, betonten die Referierenden. Rassistische und rechtsextremistische Äußerungen böten jedoch gute Anlässe, um unausgesprochene Themen zu bearbeiten und darüber ins Gespräch zu kommen. Sie böten die Möglichkeit, am konkreten Beispiel demokratische Strukturen und Kultur auszubauen und die Chance, gestärkt in die Zukunft zu gehen
Fallwerkstätten
Anschließend ging es in die Fallarbeit. Mettler und Schumacher hatten zwei Beispielfälle mitgebracht, welche die Teilnehmenden in vier Arbeitsgruppen bearbeiten. Im ersten Fall ging es um Schüler:innen, die im Klassenchat rechtsextreme und rassistische GIFs und Memes verbreiteten. Die Schulleitung war zwar über die Vorfälle informiert, ging laut Szenario aber davon aus, dass es sich um typisches jugendliches Verhalten handele, das nur politisch aufgeladen werde. Im zweiten Fall ging es ebenfalls um rassistische und rechtsextreme Äußerungen und Stereotype. Mit diesen wurden Schüler:innen im Klassenchat beleidigt und herabgewürdigt. Darauf angesprochen gaben die Verfasser:innen an, die Äußerungen seien lediglich ‚im Spaß‘ getätigt worden und waren sich keiner Schuld bewusst.
Die Referierenden baten die Teilnehmenden nun, die Fälle anhand von drei Leitfragen zu diskutieren:
- Was könnten die Folgen für die verschiedenen Akteur:innen sein, wenn sie nicht handeln?
- Für die Schüler:innen, die die rechtsextremen Inhalte versenden
- Für Schüler:innen in der Klasse, die von den rassistischen Inhalten betroffen sind
- Für die „unbeteiligten“ Schüler:innen, die sich zu den Inhalten bisher noch nicht geäußert haben
- Handlungsschritte und Akteur:innen (z.B. Lehrkräfte, Schüler:innen, Eltern)
- Welche sind mögliche Handlungsschritte?
- Wie unterscheiden sich diese für die verschiedenen Akteur:innengruppen?
- Wer sollte in den Prozess eingebunden werden?
- Mit welchem Zweck?
- Welche Ressourcen würden die einzelnen Akteur:innen mitbringen?
Nach der Diskussion in den Arbeitsgruppen kamen die Teilnehmenden wieder im Plenum zusammen, um gemeinsam die Ergebnisse zu diskutieren. In den Präsentationen wurde deutlich, dass sich Folgen, Handlungsschritte und daran beteiligte Akteur:innen je nach Fall und aus Sicht der Teilnehmenden durchaus unterschieden. Dies galt auch für die Frage, welche Akteur:innengruppen zu welchem Zweck und an welcher Stelle im Prozess in die Aufarbeitung einbezogen werden sollten. Personen, die im Klassenchat rassistisch beleidigt wurden, müssten anders in die Aufarbeitung eingebunden werden als ‚Unbeteiligte‘, z.B. andere Klassenmitglieder, die die Beleidigungen zwar mitbekommen hätten, aber nicht selbst beleidigt wurden. Manchmal biete es sich an, das Kollegium mitzunehmen oder die Schulleitung einzubeziehen, manchmal aber auch nicht. Diese Entscheidung müsse von Fall zu Fall erneut getroffen werden.
Aus Sicht des Projekts CleaRNetworking unterstützt das von Mettler und Schumacher vorgestellte Ablaufschema schulisches Personal dabei, Fälle von (nicht nur) rassistischen und rechtsextremen Äußerungen in Klassenchats strukturiert, systematisch und mit Blick auf die verschiedenen Bedarfe der betroffenen Akteur:innen bearbeiten zu können. Es ermöglicht zudem die Ausarbeitung und das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven, wie die Klasse, aber auch schulisches Personal nach den Vorfällen künftig respektvoll miteinander auskommen können. Die in diesem Bericht beschriebenen Tipps und Umgangsstrategien hat die mobile Beratung auch in einer praxisorientierten Broschüre zusammengefasst. Diese kann kostenfrei über die Homepage des Bundesverbands heruntergeladen werden [2].
Literatur:
[1] Bundesverband Mobile Beratung gegen Rechts (o.J.): Homepage. Online verfügbar unter: https://bundesverband-mobile-beratung.de/.
[2] Bundesverband Mobile Beratung gegen Rechts (2022): https://bundesverband-mobile-beratung.de/publikationen/was-machen-wir-denn-jetzt-zum-umgang-mit-rechten-inhalten-in-klassenchats/.