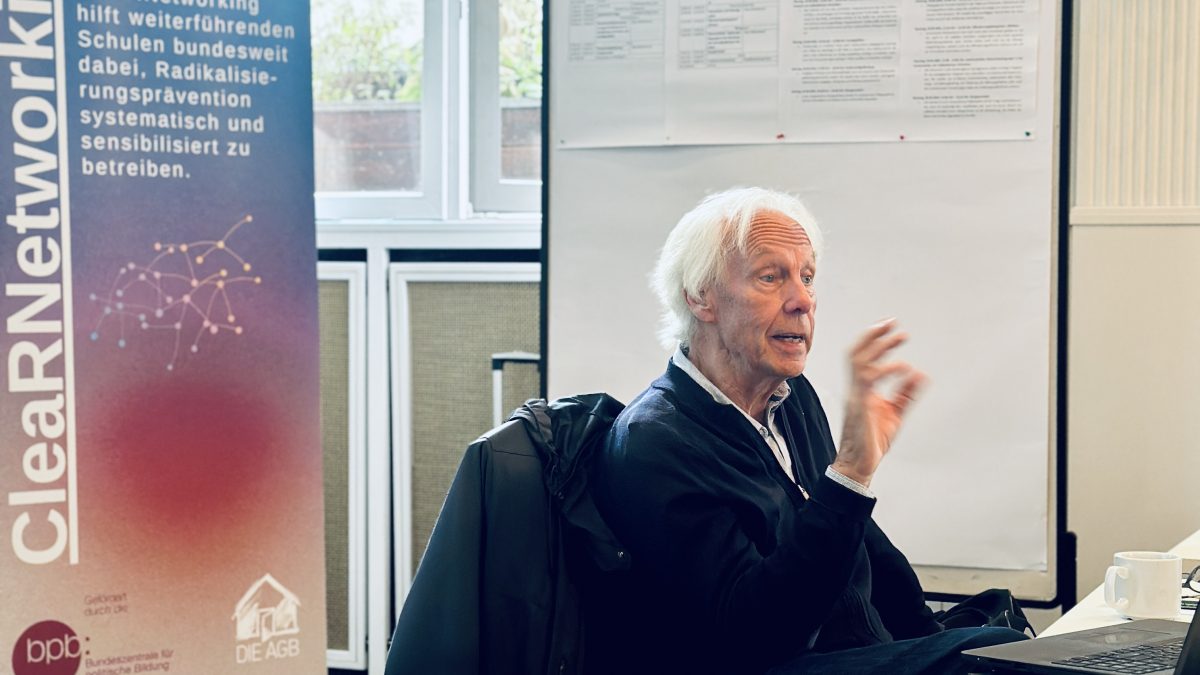Vom 29. bis 30. September fand das Modul 7 des CleaRNetworking-Jahrgangs 2025 im Hotel Essener Hof statt. Im Fokus standen die rechtlichen Rahmenbedingungen schulischer Radikalisierungsprävention und die Frage, wie schulisches Personal unter unterschiedlichen Landes- und Gerichtspraxen handlungssicher agieren kann. Als Referent:innen waren der emeritierte Prof. Dr. iur. Klaus Riekenbrauk sowie die Lehrerin und politische Bildnerin Gabi Elverich eingeladen. Thematisch spannte das Modul den Bogen von strafrechtlichen Bestimmungen im Kontext radikalisierten Verhaltens über Anzeigepflichten, landesrechtliche Schulvorgaben, Kindeswohl, Datenschutz, Schweigepflicht und Offenbarungsregeln bis hin zu Fragen politischer und religiöser Neutralität im Schulalltag.
Zentrale Erkenntnisse für die Praxis (Kurzüberblick)
- Kinderschutz zuerst: Schrittfolge nach § 4 KKG (erörtern, Hilfen anbahnen, ggf. Jugendamt informieren; Rückmeldung einfordern). Einzelfall prüfen, Gefährdung dokumentieren.
- Schweigepflicht mit Augenmaß: Intern teilen, was zur Aufgabenerfüllung nötig ist; extern nur mit Rechtsgrund (Einwilligung, gesetzliche Pflicht, Notstand). Verantwortung bleibt bei der einzelnen Fachkraft.
- Offenbaren, wenn verpflichtet oder gerechtfertigt: § 138 StGB bei geplanten schweren Straftaten; KKG bei Kindeswohl; § 34 StGB im Notstand. Abwägung und Dokumentation sind entscheidend.
- Neutralität heißt Haltung + Didaktik: Wertegebunden handeln, menschenfeindliche Positionen klar zurückweisen, zugleich kontrovers unterrichten (Beutelsbacher Konsens). Spielräume nutzen, Landesrecht beachten.
- Polizei klug einbinden: Präventiv kooperieren, bei Anzeigen Folgewirkungen einkalkulieren; in unklaren Lagen zunächst anonymisierte Fachgespräche führen.
- Unterschiede anerkennen: Auslegung variiert je nach Bundesland, Gericht und Verwaltungspraxis; „der“ eine richtige Weg existiert selten – ein rechtlich tragfähiger, dokumentierter Prozess dagegen schon.








Rückblick und Alltagsrepertoire: Kurz, klar, deeskalierend – Orientierung für spontane Situationen
Zu Beginn blickten die Teilnehmenden auf Modul 6 zurück. Aufhänger war das Kinderbuch „Wir Kinder aus dem Flüchtlings Heim“, dessen Anliegen es ist, geflüchtete Kinder nicht auf die Fluchtbiografie zu reduzieren, sondern in ihrer Vielschichtigkeit sichtbar zu machen. Ausgehend davon diskutierte das Plenum, wie man im Alltag knapp und wirksam auf diskriminierende Äußerungen Dritter reagieren kann – etwa an der Bushaltestelle, beim Einkaufen oder in familiären Gesprächen. Da für ausführliche Debatten in solchen Situationen selten Zeit bleibt, kam aus der Gruppe die EMpfehlung auf, sich im Vorfeld einen kurzen, möglichst universell nutzbaren Standardsatz zurechtzulegen, der Ablehnung markiert, ohne in Konfrontation zu eskalieren. Ergänzend wurden als hilfreiche Grundsätze benannt: eine Reflexionsfrage stellen statt zu debattieren, die eigene Nichtzustimmung klar benennen und gleichzeitig die emotionale Distanz wahren, um das Gespräch zu versachlichen.
Systemische Fragetechniken: Beziehung vor Deutung – üben, rotieren, reflektieren
Auf vielfachen Wunsch folgte eine kompakte Wiederholung systemischer Fragetechniken. In Dreiergruppen simulierten die Teilnehmenden Beratungsgespräche im Rahmen eines Clearing-Verfahrens: eine Schülerin, die polarisierende Nahost-Beiträge teilt und häufig mit Lehrkräften aneckt; ein Schüler, der sich in Gamingwelten zurückzieht und Influencern mit misogynen und sozialdarwinistischen Thesen folgt; sowie ein Jugendlicher aus einer Ultraszene, der martialische „Wir-gegen-die“-Videos teilt. Die Rollen – Clearing-Beauftragte:r, Schüler:in und Beobachtung – rotierten. In der Auswertung wurde deutlich, wie stark Gespräche profitieren, wenn vorschnelle Deutungen zurückgestellt werden. Mehrere Teilnehmende betonten, dass man sich die „übliche Gesprächssystematik“ abgewöhnen müsse: Nicht mit Hypothesen starten, sondern mit Interesse und Beziehung. Nur über die Beziehungsarbeit lasse sich tragfähige Veränderung anstoßen.
Strafrecht im Überblick: Jugendstrafrecht und Erziehungsauftrag – Spielräume der Gerichte
Im Anschluss übernahm Prof. Dr. Klaus Riekenbrauk und der Fokus des Moduls rückte auf rechtliche Fragen der schulischen Radikalisierungsprävenion. Er skizzierte zunächst die Grundstruktur des Strafrechts als Rahmen verbotenen Verhaltens und ordnete Deliktsgruppen ein, die im schulischen Kontext relevant werden können, darunter Gewaltdelikte mit extremistischer Motivation und Äußerungsdelikte. Besonderes Gewicht legte er auf das Jugendstrafrecht: Unter 14 Jahren sind Kinder strafunmündig; 14- bis 17-Jährige fallen unter das Jugendgerichtsgesetz (JGG) mit seinem Erziehungsauftrag; bei 18- bis 20-Jährigen entscheidet die Reife, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet. Dieser Erziehungsgrundsatz – präventiv wirksame Erziehung statt Vergeltung – prägt die Auswahl von Maßnahmen, die von Arbeitsstunden über soziale Trainings bis hin zu stationären Maßnahmen reichen. Zugleich zeigte Riekenbrauk die Spielräume der Gerichte auf: Ob bei Heranwachsenden Jugend- oder Erwachsenenrecht greift, ist eine Einzelfallentscheidung; die Praxis unterscheidet sich regional, auch weil Schul- und Verwaltungsrecht Ländersache sind.
Meinungsfreiheit vs. Strafbarkeit: Öffentlichkeit und Kontext – feine juristische Linien
Anhand einschlägiger Tatbestände – von Volksverhetzung über Gewaltdarstellungen bis zum Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Billigung bestimmter Straftaten – wurde die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Strafbarkeit ausgelotet. Diskutiert wurden feine Unterschiede wie Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen sowie die Frage, wann Handlungen „öffentlich“ sind. Für die schulische Praxis heißt das: Nicht jede problematische Aussage oder Symbolik ist automatisch strafbar; entscheidend sind Kontext, Tatvariante und – je nach Norm – die Frage der Öffentlichkeit. Das führt zu unterschiedlichen Bewertungen: Ein Hitlergruß kann unter bestimmten Umständen eindeutig strafbar sein; eine abwertende Aussage kann je nach Form, Adressat:innenkreis und Situation verschiedene Deliktstatbestände berühren – oder pädagogisch, aber nicht strafrechtlich relevant sein. Genau hier entstehen die bekannten Graubereiche, in denen Schulrecht, Schulaufsicht und lokale Gerichtspraxis unterschiedlich akzentuieren.
Präventionspraxis und Anzeigepflichten: Abwägen, dokumentieren, melden – länderabhängige Wege
Vor diesem Hintergrund widmete sich das Plenum der schulischen Präventionspraxis und der Anzeigepflicht. Klar benannt wurde: Eine allgemeine strafrechtliche Pflicht, begangene Taten anzuzeigen, besteht nicht; eine Pflicht greift insbesondere bei der Kenntnis von geplanten, noch abwendbaren schweren Straftaten. Gleichzeitig verlangen schulrechtliche Regelungen – je nach Land – eine Meldung an die Schulleitung, gegebenenfalls an Polizei, Jugendamt oder weitere Behörden. Wiederkehrende Praxisfrage war, wann Schulen Fälle anzeigen sollten und wann pädagogische Bearbeitung im Vordergrund stehen darf. Auch die Rolle des Jugendamts wurde kontrovers beleuchtet: Formal sieht das Gesetz eine zeitnahe Rückmeldung vor; in der Praxis bleibe diese Rückmeldung nicht selten aus, was die schulische Begleitung der betroffenen Schüler:innen erschwert. Daraus leitete die Gruppe die Bedeutung guter Dokumentation, klarer Zuständigkeiten und verlässlicher Kommunikationswege ab.
Neutralität im Alltag: Haltung zeigen – didaktisch kontrovers, parteipolitisch zurückhaltend
Mit Beginn des zweiten Tages setzte Gabi Elverich die juristischen Linien in Beziehung zur pädagogischen Praxis. Ihr Kernpunkt: Rechtliche Rahmen sind Leitplanken – sie begrenzen und ermöglichen zugleich. Der Auftrag der Schule bleibt pädagogisch; Präventionsarbeit braucht Haltung, Beziehung und didaktische Klarheit. Das häufig missverstandene „Neutralitätsgebot“ bedeute keine politische Enthaltsamkeit, sondern parteipolitische Zurückhaltung im Amt bei gleichzeitiger Pflicht, verfassungsfeindlichen Tendenzen entgegenzutreten und menschenfeindliche Positionen im Unterricht klar zu markieren. Maßstab sind die Bildungs- und Erziehungsziele sowie der Beutelsbacher Konsens: nicht überwältigen, Kontroverses kontrovers darstellen, an der Lebenswelt der Schüler:innen anknüpfen. Für den Alltag empfahl Elverich, Unklarheiten offen zu adressieren – etwa unbekannte Sticker, Logos oder T-Shirts zunächst erklären zu lassen – und Veränderungen bei Schüler:innen wertschätzend zu spiegeln: Sorge ausdrücken, Unschuldsvermutung wahren, Respekt vor der Person deutlich machen, zugleich Verhalten adressieren und konsequent sanktionieren, wo nötig. Glaubwürdigkeit entsteht, wenn die Erwachsenen dieselben Regeln für sich gelten lassen, Vertraulichkeit achten und verlässliche Grenzen setzen. Kritisch wies Elverich darauf hin, dass vermeintlich religiös begründete Radikalisierung zuweilen vorschnell dramatisiert wird, während Rechtsextremismus eher relativiert werde. Umso wichtiger sei es, Konzepte, Strategien und Regeln transparent zu verschriftlichen und so eine gemeinsame, verbindliche Grundlage im Kollegium zu schaffen – bei allem Bewusstsein dafür, dass rechtliche Bewertungsspielräume bestehen und länderspezifische Unterschiede zu berücksichtigen sind.
Rechtsrahmen vertieft: Datenschutz, Schweigepflicht und Offenbarung – Orientierung im Spannungsfeld
Anschließend übernahm wieder Riekenbrauk, knüpfte an die angesetzte juristisch-pädagogische Doppelperspektive an und vertiefte vier Bereiche, die im schulischen Alltag regelmäßig miteinander kollidieren: Datenschutz, Schweigepflicht, Offenbarungsbefugnisse und -pflichten sowie Neutralität. Dabei ging es nicht darum, Eindeutigkeit vorzuspiegeln, wo sie rechtlich nicht existiert, sondern darum, schulischem Personal Orientierung zu geben, wie man in Spannungsfeldern handeln kann. Durchgängig wurde betont, dass sich Urteile und Verwaltungspraxis zwischen Bundesländern unterscheiden können und dass Gerichte bestimmte Fragen unterschiedlich auslegen. Handlungssicherheit entsteht daher weniger durch „eine richtige Lösung“, sondern durch ein nachvollziehbares Vorgehen entlang der einschlägigen Rechtsgrundlagen – plus sauberer Kommunikation im Kollegium und mit der Schulleitung.
Kindeswohlgefährdung: Was Schule tun muss – und was andere übernehmen
Ausgangspunkt ist das elterliche Erziehungsrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG und das staatliche Wächteramt. Für die Schule heißt das: Sie achtet die Elternautonomie, muss aber reagieren, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Das kann in Radikalisierungskontexten durch aktive extremistische Erziehung (Indoktrination) oder durch Vernachlässigung passieren. Maßgeblich ist dabei stets der konkrete Einzelfall, nicht die politische oder religiöse Verortung einer Familie an sich. § 1666 BGB verpflichtet das Familiengericht zu Schutzmaßnahmen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und Eltern die Gefahr nicht abwenden (bis hin zu Auflagen, Kontaktverboten oder – verhältnismäßig – zur teilweisen oder vollständigen Entziehung der Sorge). Für schulisches Personal wichtig: „Gefährdung“ umfasst Integrität (z. B. Gesundheit), aber auch Entfaltungsinteressen (entwicklungsfördernde Beziehungen, kulturelle Teilhabe, wachsende Selbstbestimmung). Typische Indikatoren können Isolation, überzogene Verhaltensregeln, Zwangsehen, körperliche Züchtigung, dauerhafte Konfrontation mit Gewaltpropaganda oder autoritäre Erziehungsstile sein – können, nicht müssen; entscheidend ist die aktuelle, konkrete Gefahr für das Kind.
Praxisleitend ist § 4 KKG: Wird schulischem Personal in Ausübung des Berufs eine mögliche Gefährdung bekannt, sollen Lehrkräfte und Schulsozialarbeit die Situation mit Kind/Jugendlichen und Eltern erörtern und – soweit erforderlich – bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, sofern der wirksame Schutz dadurch nicht gefährdet wird. Greifen diese Schritte nicht, dürfen Daten an das Jugendamt übermittelt werden; darüber sind Betroffene grundsätzlich vorab zu informieren, es sei denn, der Schutz des Kindes würde dadurch vereitelt. Nach einer Mitteilung soll das Jugendamt zeitnah rückmelden, ob es die Gefährdung bestätigt und ob bzw. wie es tätig geworden ist (§ 4 Abs. 3–4 KKG). In der Praxis klappt diese Rückmeldung nicht immer – das wurde von Teilnehmenden deutlich kritisiert –, rechtlich ist sie gleichwohl vorgesehen. Ergänzend verpflichtet § 8a SGB VIII das Jugendamt zu einer Gefährdungseinschätzung im Mehr-Fachkräfte-Verfahren, ggf. mit Hausbesuch, und zur Angebotserstellung bzw. Inobhutnahme in akuter Gefahr. Für Schulen zentral bleibt: dokumentieren, fachlich beraten, Jugendhilfe einbeziehen – und auf Rückmeldung bestehen.
Besondere Brisanz haben medizinische Notfälle mit weltanschaulichem Bezug. Wird etwa eine lebensrettende Bluttransfusion aus religiösen Gründen abgelehnt, kann über das Familiengericht per einstweiliger Anordnung in sehr kurzer Frist eine Pflegschaft für Gesundheitsfragen eingerichtet werden; im Notstandsfall geht der Schutz von Leben und Gesundheit vor. Auch Schulgesetze betonen die Verantwortung schulischen Personals für das Wohl der anvertrauten Kinder – nötigenfalls gegen den erklärten Willen der Eltern. Diese Linie entspricht der Logik von § 1666 BGB: Es zählt der Schutz des Kindes im Einzelfall; Eingriffe müssen verhältnismäßig sein.
Datenschutz und Schweigepflicht: Schutz der Vertrauensbeziehung – mit klaren Ausnahmen
Datenschutz und Schweigepflicht schützen die informationelle Selbstbestimmung und sind Grundlage vertrauensvoller pädagogischer Beziehungen. Für beamtete Lehrkräfte gilt die Verschwiegenheitspflicht aus dem Beamtenrecht; dienstliche Mitteilungen sind jedoch zulässig bzw. geboten, wenn sie zur Aufgabenerfüllung notwendig sind – insbesondere gegenüber der Schulleitung, die zu beraten und zu unterstützen ist (§ 35 BeamStG). Für Schulsozialarbeinde greift § 203 Abs. 1 StGB, für Lehrkräfte § 203 Abs. 2 StGB: Ein unbefugtes Offenbaren von Geheimnissen ist strafbar. Zugleich erlaubt und verlangt das Schulrecht die Verarbeitung und – in engen Grenzen – die Übermittlung personenbezogener Daten, wenn es zur Erfüllung schulischer Aufgaben erforderlich ist (z. B. § 120 SchulG NRW, inkl. Übermittlungsbefugnissen an Jugendamt, Schulaufsicht etc., sofern jeweils aufgabenbezogen). Die persönliche Verantwortung bleibt immer bei der einzelnen Fachkraft; Verwaltungsvorschriften heben die Strafbarkeit eines Geheimnisbruchs nicht auf. Einwilligungen – auch durch einsichtsfähige Minderjährige ab ca. 14 Jahren – können die Schweigepflicht rechtfertigend entbinden; ob Einsichtsfähigkeit vorliegt, beurteilt die jeweilige Lehrkraft.
Für die Praxis bedeutet das: Innerhalb der Schule dürfen Informationen an diejenigen weitergegeben werden, die sie zur Aufgabenerfüllung brauchen (z. B. Schulleitung, Beratungsteam). Außerhalb der Schule ist die Schwelle höher. Eine Datenweitergabe an das Jugendamt ist zulässig, soweit es für die Gefährdungseinschätzung erforderlich ist; an Polizei oder andere Behörden kommt sie in Betracht, wenn eine ausdrückliche gesetzliche Pflicht besteht oder eine rechtfertigende Einwilligung/Notlage vorliegt. In jedem Fall sollte der Entscheidungsweg dokumentiert werden: Anlass, Rechtsgrund, Abwägung, Beteiligte, Ergebnis.
Offenbarungsbefugnisse und -pflichten: Wann Schweigen bricht – und warum
Die klare Offenbarungspflicht ergibt sich insbesondere bei Kenntnis bestimmter geplanter schwerer Straftaten (§ 138 StGB). In diesen Fällen sind personenbezogene Daten an Ermittlungsbehörden oder die bedrohte Person zu übermitteln; darüber hinaus gibt es keine generelle strafbewehrte Anzeigepflicht. In Kinderschutzkonstellationen ist die Übermittlung an die insoweit erfahrene Fachkraft bzw. an das Jugendamt zulässig, wenn sie zur Gefährdungseinschätzung erforderlich ist oder Eltern die Zusammenarbeit trotz Gefahr verweigern (§ 4 Abs. 2–3 KKG). Zwischen Schweigepflicht und Elternrechten kann es kollidierende Pflichten geben; hier gilt die Einzelfallabwägung – regelmäßig darf und muss die Schule informieren, wenn die Erziehungsaufgabe der Eltern ohne diese Information nicht erfüllbar wäre. Schließlich erlaubt der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) ein Geheimnis zu offenbaren, wenn nur so eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für besonders gewichtige Rechtsgüter (Leben, Gesundheit, sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit u. a.) abgewendet werden kann und mildere Mittel nicht ausreichen.
Praktisch wurde diskutiert, dass Offenbarung zwar rechtlich gedeckt sein kann, aber Beziehungen beschädigt und Fälle unvorhersehbar verlaufen können. Das macht die Abstufung wichtig: zuerst pädagogisch klären und Hilfen eröffnen, parallel Risiko prüfen, dann – gut begründet – offenbaren, wenn Rechtsgrund und Notwendigkeit vorliegen. Auch der behutsame Voraustausch mit der Polizei ist möglich: ohne Klarnamen, im Konjunktiv, um Möglichkeiten zu klären, ohne schon ein Ermittlungsverfahren auszulösen. Wird trotzdem Anzeige erstattet, sollten Schule und Schulleitung antizipieren, dass der weitere Informationsfluss oft abreißt und intern Ersatzroutinen für die Begleitung des betroffenen Schülers festlegen.
Neutralität: Haltung zeigen – ohne zu indoktrinieren
Beim Thema Neutralität verdichteten sich Recht, Pädagogik und Schulkultur. Es gibt kein allgemeines politisches Neutralitätsgebot im Sinne eines „Enthaltungsgebots“ für schulisches Personal. Schulen sind an die Werte des Grundgesetzes, an Menschenrechte und an die Bildungs- und Erziehungsziele der Schulgesetze gebunden; sie müssen aktiv gegen rassistische, antisemitische, antimuslimische und andere menschenfeindliche Äußerungen vorgehen. Zugleich gelten Beamtenpflichten zur Mäßigung und zur unparteiischen Amtsführung; im Unterricht ist Einseitigkeit verboten, kontroverse Positionen sind als kontrovers darzustellen (Beutelsbacher Konsens: Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot, Lernendenorientierung). Diese Doppelbindung – klare wertegebundene Haltung und didaktische Balance – ist leitend für Unterricht und Schulöffentlichkeit.
Die Fallarbeit zeigte, wie Schulen ihre Spielräume nutzen: Vor Wahlen können Podien geplant werden, die allen demokratischen Parteien offenstehen; zugleich ist es legitim und aus Schutzgründen geboten, genau zu prüfen, wer auftritt und ob dessen dokumentierte Äußerungen mit den Bildungs- und Erziehungszielen vereinbar sind. Im Unterricht dürfen rechtsextreme Positionen klar als verfassungswidrig markiert werden; didaktisch sinnvoll ist, Programme und tatsächliche Praxis zu kontextualisieren statt singulär und losgelöst zu kritisieren. Räume der Stille sind für alle Religionen/Weltanschauungen möglich; eine Exklusivnutzung für eine einzige Religion kollidiert mit dem staatlichen Neutralitätsgebot (Ausnahmefall: Bekenntnisschulen). Die Diskussion um religiöse Symbole (z. B. Kopftuch) wurde eingeordnet: Maßgeblich ist heute regelmäßig die konkrete Gefährdung des Schulfriedens bzw. der staatlichen Neutralität – Pauschalverbote haben verfassungsrechtlich keinen Bestand; gleichwohl sind landesrechtliche Besonderheiten und aktuelle Landespraxis zu beachten.
Polizei: Zwischen Ressource und Sanktionslogik – sorgfältig abwägen
Die Erfahrungsberichte reichten von sehr kooperativen Präventionsangeboten bis zu Frust über abreißende Kommunikation nach Anzeigen. CleaRNetworking ermutigt Schulen zu drei Linien: Polizei nicht erst als Sanktionsinstanz denken, sondern als präventive Ressource in niedrigschwelligen Gesprächen einbinden; unterschiedliche Perspektiven von Schüler:innen mit Marginalisierungserfahrungen sensibel mitdenken; und die absehbaren Folgen von Anzeigen für die weitere pädagogische Arbeit realistisch einplanen. Das ersetzt keine gesetzlichen Meldepflichten, hilft aber dabei, sie mit pädagogischer Beziehungsarbeit zu verzahnen.
Zentrale Erkenntnisse für die Praxis (Kurzüberblick)
- Kinderschutz zuerst: Schrittfolge nach § 4 KKG (erörtern, Hilfen anbahnen, ggf. Jugendamt informieren; Rückmeldung einfordern). Einzelfall prüfen, Gefährdung dokumentieren.
- Schweigepflicht mit Augenmaß: Intern teilen, was zur Aufgabenerfüllung nötig ist; extern nur mit Rechtsgrund (Einwilligung, gesetzliche Pflicht, Notstand). Verantwortung bleibt bei der einzelnen Fachkraft.
- Offenbaren, wenn verpflichtet oder gerechtfertigt: § 138 StGB bei geplanten schweren Straftaten; KKG bei Kindeswohl; § 34 StGB im Notstand. Abwägung und Dokumentation sind entscheidend.
- Neutralität heißt Haltung + Didaktik: Wertegebunden handeln, menschenfeindliche Positionen klar zurückweisen, zugleich kontrovers unterrichten (Beutelsbacher Konsens). Spielräume nutzen, Landesrecht beachten.
- Polizei klug einbinden: Präventiv kooperieren, bei Anzeigen Folgewirkungen einkalkulieren; in unklaren Lagen zunächst anonymisierte Fachgespräche führen.
- Unterschiede anerkennen: Auslegung variiert je nach Bundesland, Gericht und Verwaltungspraxis; „der“ eine richtige Weg existiert selten – ein rechtlich tragfähiger, dokumentierter Prozess dagegen schon.
Literatur
[1] Bundesministerium der Justiz (o.J): Jugendgerichtsgesetz. Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/BJNR007510953.html.
[2] Wieland, Joachim (2019): Was man sagen darf: Mythos Neutralität in Schule und Unterricht. Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/292674/was-man-sagen-darf-mythos-neutralitaet-in-schule-und-unterricht/.
[3] CleaRNetworking (2025): „Schule braucht Haltung statt falsch verstandener Neutralität“: Netzwerktreffen Neutralität, 13.05.25 – 14.05.25, Hamm
https://www.clearing-schule.de/schule-braucht-haltung-statt-falsch-verstandener-neutralitaet-netzwerktreffen-neutralitaet-13-05-25-14-05-25-hamm/.